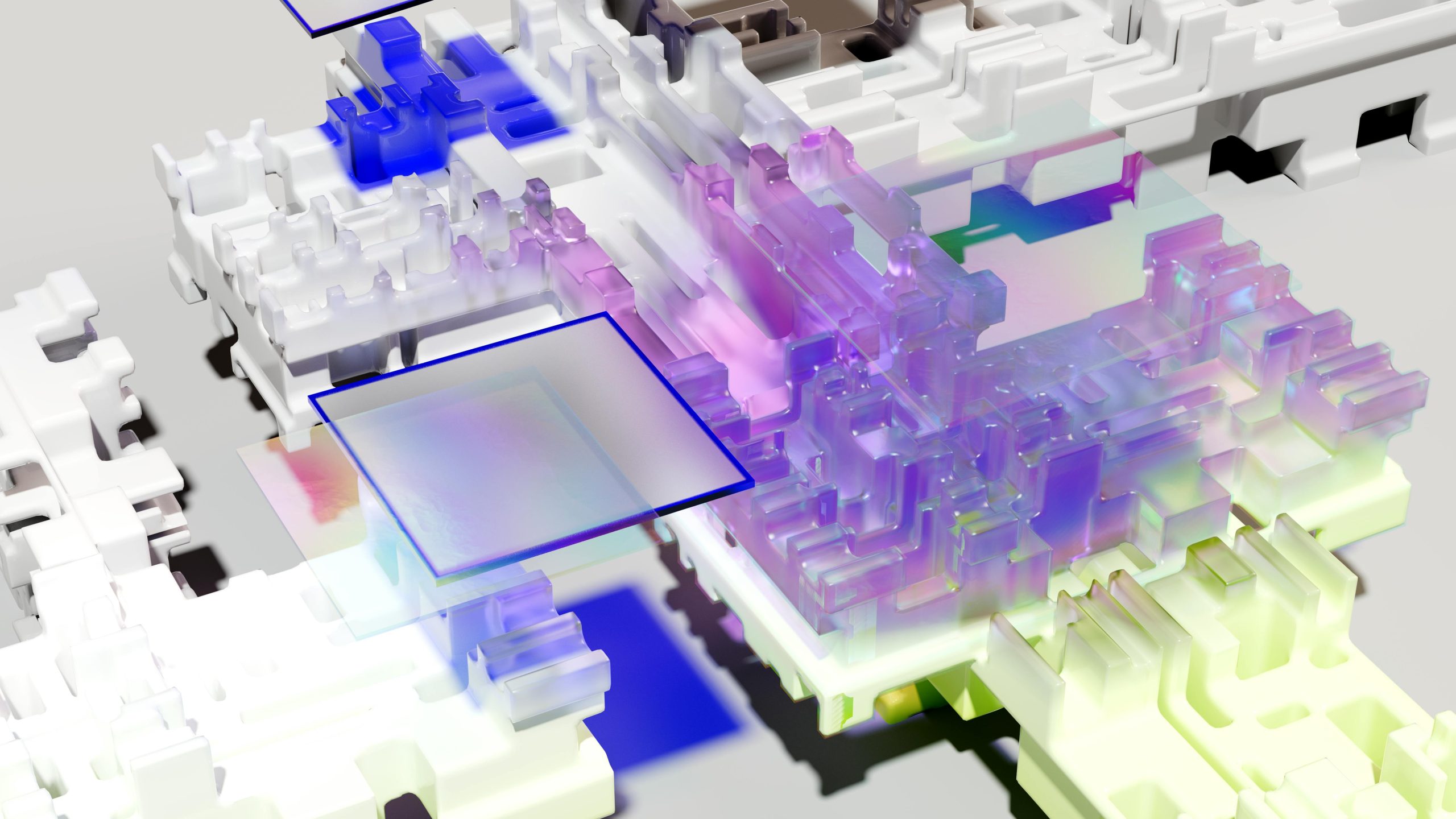Die Direktwerbung per Telefon ist schon seit vor der DSGVO immer wieder Grund für Diskussionen. Grund dazu liefert §7 Abs. 2 Nr. 1 UWG, wonach Werbung per Telefon eine unzumutbare Belästigung darstellt, es sei denn, im B2B-Bereich liegt zumindest eine mutmaßliche Einwilligung der angerufenen Person vor. Das Gesetz definiert jedoch nicht konkret, wann von einer mutmaßlichen Einwilligung ausgegangen werden kann.
Wie hat es begonnen?
Bereits vor der DSGVO vertraten die Aufsichtsbehörden die Meinung, dass der bloße Eintrag einer Telefonnummer in einem öffentlichen Verzeichnis oder auf der Webseite nicht ausreicht, um von einer mutmaßlichen Einwilligung auszugehen. Immerhin werden diese Kontaktdaten benötigt, damit potenzielle und bestehende Kunden mit dem Unternehmen Kontakt aufnehmen können.
Im vorliegenden Fall hat die saarländische Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit bereits 2017 einem Unternehmen die Nutzung von öffentlich zugänglichen Rufnummern zur Nutzung für die eigene telefonische Direktwerbung verboten. Gegen dieses Verbot wehrte sich das Unternehmen mit dem Verweis auf die neue Rechtslage durch die DSGVO.
Was wurde entschieden?
Gemäß dem aktuellen Urteil des Bundesverfassungsgerichts ändert auch die DSGVO nichts an der Rechtslage und damit an dem ausgesprochenen Verbot. Die Direktwerbung wird zwar von der DSGVO in Erwägungsgrund 47 als mögliches berechtigtes Interesse angegeben, jedoch widerspricht die EU-Richtlinie 2002/58/EG zum Datenschutz in der elektronischen Kommunikation dieser Auslegung. Daher ist die Interessenabwägung zugunsten des Verantwortlichen im Rahmen der telefonischen Kaltakquise unwahrscheinlich.
Konkret wurde im vorliegenden Urteil jedoch nur entschieden, dass der Verkauf von Edelmetallresten zur Gewinnerzielung weder typisch noch wesentlich für die Tätigkeit eines Zahnarztes ist und daher in diesem Fall zudem ebenfalls keine mutmaßliche Einwilligung vorliegt.
Woran sich eine mutmaßliche Einwilligung messen lassen?
Bei der eigenen Bewertung, ob eine mutmaßliche Einwilligung vorliegt, wird also vor allem zu berücksichtigen sein, ob die angebotene Leistung mit der Kerntätigkeit des Adressaten kompatibel ist. Würde die angebotene Leistung einen Mehrwert für die Tätigkeit des Adressaten darstellen?
Möglicherweise könnte man ebenfalls zu einem positiven Ergebnis kommen, wenn ein erster Kontakt bereits auf einer Messe oder Veranstaltung geknüpft wurde oder wenn idealerweise bereits ein vertragsähnliches Vertrauensverhältnis zwischen den Parteien besteht – auch wenn wir in einem solchen Fall natürlich nicht mehr von einer Kaltakquise sprechen.
Entscheidend bleibt also der Einzelfall, weshalb die telefonische Kaltakquise auch zukünftig für ausreichend Diskussions- und Streitpotenzial sorgen wird.
Quelle: https://www.bverwg.de/pm/2025/5